Kabel und Leitungen Agil und flexibel zur Datenleitung 4.0
Lapp vollzieht einen Strategiewandel im Innovationsmanagement. Daraus resultieren einige Neuheiten rund um die elektrische Verbindungstechnik für Industrie 4.0. Wir verraten, was dahintersteckt.
Anbieter zum Thema

Fragt man Unternehmer, welche Geschäftsmodelle ihnen beim Thema Industrie 4.0 einfallen, werden viele die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) nennen. Sie verspricht, dass Maschinen und Anlagen nie mehr überraschend ausfallen. Durch das kontinuierliche Sammeln von Betriebsdaten sollen drohende Defekte früh erkannt werden, damit man ein verschlissenes Teil austauschen kann, bevor es zu einem Stillstand in der Produktion und zu hohen Kosten kommt.
Auch Lapp arbeitet an Lösungen für die vorausschauende Wartung. Leitungen sind in der Regel sehr robust und langlebig, doch auch eine Leitung kann ausfallen. Oder sie wird bei einer routinemäßigen Instandhaltung ausgetauscht, obwohl sie noch in Ordnung wäre. Beides kostet unnötig Geld.

Datenleitungen überwachen
Wie man das vermeiden kann, hat Lapp auf der Hannover Messe 2019 gezeigt. Das Unternehmen hat ein System entwickelt, das Datenleitungen überwacht und aus nachlassenden Übertragungseigenschaften die Alterung und die voraussichtliche Restlebensdauer der Leitung errechnet. Vorausgegangen waren umfangreiche Versuche, um die geeigneten Parameter zu finden. Diese werden mit der Datenbank verglichen, in der Lapp über Jahrzehnte in zigtausenden Tests die Alterungseigenschaften seiner Leitungen erforscht und dokumentiert hat.
Die vorausschauende Wartung für Leitungen ist ein gutes Beispiel, wie Innovationsprozesse funktionieren und wo man sie optimieren muss. Weil die Lösung technisch anspruchsvoll war, konzentrierten sich die Entwickler lange Zeit ausschließlich auf die Technik. „Niemand hat sich gefragt, welche Kunden das brauchen und wie viel sie dafür zu bezahlen bereit sind“, erklärt Guido Ege, Leiter Produktmanagement und Entwicklung bei Lapp. „Auf der Hannover Messe war das Interesse dann riesig“, sagt Ege. „Nun wollen wir mit Pilotkunden ein passendes Geschäftsmodell dazu entwickeln.“
Prozess für disruptive Innovation
Dafür hat Lapp einen neuen Prozess für das Innovationsmanagement entworfen: den Innovation-for-Future-Prozess. Diese Herangehensweise eignet sich vor allem für radikale und disruptive Innovationen, die mit dem bewährten Stage-Gate-Prozess nicht zu steuern sind. Bei Stage-Gate gibt das Management bereits ganz zu Anfang Ziele vor, die schrittweise zu erfüllen sind – dazu gehören auch Einschätzungen über Umsatz- und Gewinnchancen. Doch wenn die Lapp-Entwickler Neuland betreten, gibt es diese Ziele möglicherweise noch gar nicht. In der Stage-Gate-Denke könnte das Projekt nicht starten, denn für etwas noch nie da gewesenes Gewinnerwartungen anzugeben, ist kaum möglich.
Der Innovation-for-Future-Prozess dagegen schafft Freiräume, neue Technologien und Geschäftsmodelle zu entwickeln, für die bislang erst vage Ideen existieren.
Lapp hat dafür drei Voraussetzungen definiert, die parallel zu erfüllen sind. Das Innovationsteam muss:
- 1. eine technische Lösung entwickeln,
- 2. mit mindestens einem potenziellen Kunden sprechen und
- 3. einen Business Model Canvas erstellen, in dem alle neun Elemente ausgefüllt sind.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1531300/1531316/original.jpg)
Switche und Leitungen
Aktive und passive Komponenten für die Datenkommunikation
Doch das sind nur die Formalien. Der entscheidende Unterschied ist die Rolle des Managements. Statt bisher nur in definierten Intervallen „Ja“ oder „Nein“ zu einem Entwicklungsstand zu sagen, sind Führungskräfte künftig als Ideengeber und Unterstützer – neudeutsch: Enabler – gefragt. Sie knüpfen für das Innovationsteam Netzwerke und stellen das Budget bereit, womit nicht nur Geld gemeint ist, sondern auch zeitlicher Freiraum. „Stage-Gate ist damit aber nicht tot“, sagt Guido Ege. Es sei vielmehr im Innovation-for-Future-Prozess enthalten und für inkrementelle Innovationen, etwa für einen neuen Kabeltyp auf Basis eines Vorgängerprodukts, nach wie vor die Methode der Wahl.
Downsizing für Datenleitungen
Ein gutes Beispiel dafür ist Single-Pair Ethernet, ein Konzept, das ebenfalls mit Industrie 4.0 zusammenhängt.
Die Zahl der Datenverbindungen zwischen Maschinen steigt in Folge der Digitalisierung in den Fabriken rasant an, vor allem weil immer mehr Anlagen mit Sensoren ausgerüstet werden. Sie erzeugen große Datenmengen, die unter anderem für die vorausschauende Wartung nötig sind. Am meisten von diesem Vernetzungsboom profitiert Industrial Ethernet. Sieht man einmal von schnellen und hochauflösenden Kameras ab, senden viele der Sensoren nur kleine Datenmengen, etwa Druck, Temperatur oder ähnliche Messwerte. Dafür ist eine schnelle Cat.6A-Leitung völlig überdimensioniert, eine Leitung mit geringerer Datenrate tut es auch. Single-Pair-Ethernet-Leitungen haben deshalb statt vier Aderpaaren nur ein Aderpaar. Damit können Sie immer noch ein 1Gbit/s übertragen – statt zehn wie bei Cat.6A –, und das ist schnell genug für viele Anwendungen, außerdem sind sie dünner, platzsparender und kostengünstiger.
Single-Pair Ethernet ist weder technologisch noch vom Geschäftsmodell Neuland. Es ist eine Variante bestehender Leitungen, für die es wachsenden Bedarf geben wird. Daher war hier – anders als bei der neuartigen Lösung zur vorausschauenden Wartung von Leitungen – der Stage-Gate-Innovationsprozess genau passend. Die ersten Leitungen dieses Typs hat Lapp auf der Hannover Messe 2019 gezeigt.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1562500/1562581/original.jpg)
Anschlusstechnik
Rundsteckverbinder im Überblick: übertragen, anschließen und verriegeln
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1536300/1536334/original.jpg)
Kabel und Leitungen
Single Pair Ethernet – die DNA des IIoT
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1272700/1272792/original.jpg)
Elektrische Verbindungstechnik
Wenn die Leitung mitdenkt
(ID:45961835)




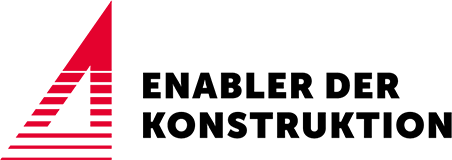
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/52/7a/527ad5ae7d10b9e34b72570639d7870c/plagiarius-zwerg-gnome-2849x1602v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ef/04/ef0475f1203cde94bf9dfde98fd7345b/0129243542v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8a/12/8a1258b6d4701a389972fbb92278f515/0129242059v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/82/df/82df058e441537e2123e8d0ee81c22be/bank-notes-941246-1280-1280x720v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/ef/1defae065aa8e85d07d6ee617335c88f/0128924879v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/65/75655982e3a71a70efcf8c1de423bc13/0128784466v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/39/42/3942b4485d407f41c125113ab81cfc08/grenzebach-am-fsw-gads-herfert-gfsw-burmann-spin-off-close-shot-2000x1125v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/da/7e/da7e5a5df4c0efb2a27aa760dd94ba4f/0129346755v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5e/9b/5e9b393c4e5d987e895de5ce4527df87/0129242091v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/42/18421d21f5a2ad15081c1a738e84850f/0128496303v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/97/54/97546a872190f725e761a6504088f5b9/0127947665v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/c2/75c2648ac64e595c51904d8dbaceabea/0128063829v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/ad/e1ad97c78305431215cab0ae08ddfc1e/laj987-digital-grading-10006743-1280-1280x720v1.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/8b/ec8b9c991b5c25fdc483a9c4f062c01f/adobestock-340905887--c2-a9-20gorodenkoff-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5120x2877v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6d/b5/6db5864ad31a14bd4db1e228f983c259/adobestock-1336831159--c2-a9-20magele-picture-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5184x2915v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bc/49/bc4957f73a884d8ee1356914659cf2f4/adobestock-325234002--c2-a9-20karyna-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5490x3087v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7a/22/7a22898e1ee01157399158bd2d7f26c6/0128676654v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/46/c9/46c97200605642d8b8f9bc9ac014316a/0128359318v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/16/7916e9b7731fb39679d596d16f918a8f/0127591377v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/93/e193cd7df3b15859208fa33b610588ad/0127840781v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/61/4f/614f0d08c8ea93498a6c6883d7701f25/0126917376v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/89/c7894b3aecafb36267fab2853c93499c/0126696654v1.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/55400/55419/65.jpg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/113400/113491/65.gif)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/113800/113818/65.jpg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/114400/114404/65.jpg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c3/d3/c3d3f0fcc6ae56b004540ec9e0166161/0128065710v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5d/11/5d112b58af0aeb52b0c121559c477b78/0126210920v3.jpeg)