Schutzzäune So wählen Sie den geeigneten Schutzzaun aus
Im Anhang der neuen DIN EN ISO 14120 werden Testverfahren von festen und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen beschrieben. Dies wirft die Fragen auf: Wie stabil muss ein Schutzzaun sein und welche konkreten Anforderungen muss er erfüllen?
Anbieter zum Thema

Zurzeit befindet sich die Norm DIN EN ISO 14120 „Sicherheit von Maschinen – Trennende Schutzeinrichtungen – Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen“ noch in der finalen Abstimmungsphase. Größere Änderungen sind jedoch nicht mehr zu erwarten. Die deutsche Fassung der Norm wurde im Herbst 2013 als prEN ISO 14120:2013 veröffentlicht. Sie wird die EN 953 ersetzen und als ISO-Norm nicht nur EU-weit, sondern weltweit Gültigkeit haben.
Testverfahren neu beschrieben
Eine aus Hersteller- und Anwendersicht beruhigende Information vorweg: Die Norm erfindet das Rad bzw. die trennende Schutzeinrichtung nicht neu. Viele grundlegende Anforderungen wurden übernommen. Vollständig neu ist jedoch die Beschreibung eines Testverfahrens, aus dem sich letztlich auch ein neuer Ansatz für die Auswahl von trennenden Schutzeinrichtungen wie z.B. Schutzzäunen ergibt.
Zunächst ein Blick auf die normativen Rahmenbedingungen. Als künftige EN-Norm ordnet sich DIN EN ISO 14120 in die EU-Normenlandschaft zur Maschinensicherheit ein, deren grundlegende Anforderungen die Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) absteckt. Sie sagt unter Punkt 1.4 („Anforderungen an Schutzeinrichtungen“): „Trennende und nichttrennende Schutzeinrichtungen müssen stabil gebaut sein“. Die Eigenschaft „stabil“ wird jedoch nicht weiter erläutert. Etwas weiter, unter Punkt 1.4.1, heißt es: „Ferner müssen trennende Schutzeinrichtungen nach Möglichkeit vor einem Herausschleudern oder Herabfallen von Werkstoffen und Gegenständen sowie vor den von der Maschine verursachten Emissionen schützen.“
Verschiedene Funktionen von Schutzzäunen
Damit werden die verschiedenen Funktionen von Schutzzäunen beschrieben. Sie dienen nicht nur dazu, Personen am Betreten des Gefahrenbereiches zu hindern. Vielmehr ist es auch ihre Aufgabe, ein Werkstück im Gefahrenbereich zu halten, das sich z.B. vom Greifer eines Roboters gelöst hat. Ebenso kann es passieren, dass Personal gegen den Schutzzaun stürzt oder anprallt. In diesem Fall muss ebenfalls vermieden werden, dass es in den Arbeitsbereich des Roboters gerät. Eine weitere Anforderung wird oft von den Anwendern bzw. Anlagenbauern genannt und gleich noch diskutiert: Der Schutzzaun muss „roboterfest“ sein und darf sich bei einem Robotereinschlag nicht oder nur minimal verformen. Er darf auch nicht splittern, und die Befestigungselemente dürfen nicht verloren gehen.
Es ist einleuchtend, dass jede der beschriebenen Gefährdungen ganz andere Anforderungen an die Festigkeit des Schutzzauns stellt. Und es ist verständlich, dass die Anwender von Schutzzäunen verlässliche und vergleichbare Angaben darüber wünschen, was denn nun unter Stabilität zu verstehen ist. Der Entwurf der DIN EN ISO 14120 trägt dieser Tatsache Rechnung und beschreibt in seinem Anhang zwei bzw. drei Testmethoden zur Beurteilung der Stabilität von Schutzeinrichtungen.
Simulierter Sturz gegen Zaun
Die erste Testmethode ist ein Beschussversuch mit Projektilen, der auch bereits in ähnlicher Form in C-Normen – z.B. der DIN EN ISO 23125 von 2012 für Werkzeugmaschinen – beschrieben wurde. Sie zielt auf Maschinenabdeckungen aus Polycarbonat und ggfs. Blech ab. Für die Anwender von Schutzzäunen ist das zweite Verfahren interessant. Es definiert die Methodik von zwei verschiedenen Pendelschlagtests. Der erste wird von außen mit einem weichen Testkörper ausgeübt, der einem menschlichen Körper ähnelt. Simuliert wird das Stürzen eines Mitarbeiters gegen den Schutzzaun. Dabei wird angenommen, dass eine Energie von mindestens 115 J auf den Schutzzaun ausgeübt wird. Der zweite Pendelschlagtest erfolgt von innen, d.h. aus dem Gefahrenbereich hinaus. Dabei kommt ein harter Testkörper zum Einsatz, der sich in Form und Gewicht an Werkstücken und Roboterarmen orientiert.
Die Hans Georg Brühl GmbH hat schon 2009 ein Pendelschlagwerk in Betrieb genommen, mit der sich derartige Tests durchführen lassen – auch mit deutlich höheren Energien von maximal 5050 J. Ein Versuchskörper mit definierter Energie und definierter Aufprallkraft prallt dabei in verschiedene Zonen der Schutzeinrichtung (Pfosten bzw. Mitte des Zaunelementes). Eine Hochgeschwindigkeitskamera dokumentiert den Aufprall. Diese Testeinrichtung ermöglicht eine reproduzierbare Messung und Bewertung der dynamischen Belastbarkeit von Schutzeinrichtungen. Mit ihr lassen sich auch die im Anhang der DIN EN ISO 23125 beschriebenen Pendelschlagtests durchführen. Allerdings sollte der Anwender im Vorfeld prüfen, ob tatsächlich Tests erforderlich sind, die ja einen gewissen Aufwand erfordern. In vielen Fällen kann man durch den Abgleich mit Referenzwerten einen solchen Test vermeiden und dann schneller und auch kostengünstiger einen sicheren Schutzzaun auswählen.
(ID:43257603)




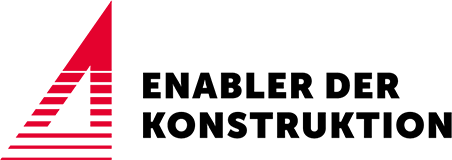
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ef/04/ef0475f1203cde94bf9dfde98fd7345b/0129243542v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8a/12/8a1258b6d4701a389972fbb92278f515/0129242059v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/db/58/db58d50add37b2bc32dcbff86b1e1f0c/0129007282v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/82/df/82df058e441537e2123e8d0ee81c22be/bank-notes-941246-1280-1280x720v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/ef/1defae065aa8e85d07d6ee617335c88f/0128924879v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/65/75655982e3a71a70efcf8c1de423bc13/0128784466v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5e/9b/5e9b393c4e5d987e895de5ce4527df87/0129242091v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/33/5c/335c0ce49c2019c75c5e3c7ee9a89b68/1x1-meldung-800x450v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/91/45/91456f599a95308e641d854b08d99305/0129062501v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/42/18421d21f5a2ad15081c1a738e84850f/0128496303v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/97/54/97546a872190f725e761a6504088f5b9/0127947665v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/c2/75c2648ac64e595c51904d8dbaceabea/0128063829v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/ad/e1ad97c78305431215cab0ae08ddfc1e/laj987-digital-grading-10006743-1280-1280x720v1.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/8b/ec8b9c991b5c25fdc483a9c4f062c01f/adobestock-340905887--c2-a9-20gorodenkoff-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5120x2877v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6d/b5/6db5864ad31a14bd4db1e228f983c259/adobestock-1336831159--c2-a9-20magele-picture-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5184x2915v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7a/22/7a22898e1ee01157399158bd2d7f26c6/0128676654v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/46/c9/46c97200605642d8b8f9bc9ac014316a/0128359318v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/16/7916e9b7731fb39679d596d16f918a8f/0127591377v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fa/52/fa52f34c60f4bd6bf6f408a9fef7b316/0127095437v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/93/e193cd7df3b15859208fa33b610588ad/0127840781v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/61/4f/614f0d08c8ea93498a6c6883d7701f25/0126917376v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/89/c7894b3aecafb36267fab2853c93499c/0126696654v1.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/113400/113491/65.gif)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/66100/66169/65.jpg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/69/04/69049bcce503a/microsonic-logo-02.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6a/bb/6abb500c6960e05b472a5c7b416aacc0/0127640276v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/20/62/2062908b8606087df2ad7d72ef85014c/0126914127v2.jpeg)