Faszination Technik Wie grüner Wasserstoff auf See erzeugt werden kann
In unserer Rubrik „Faszination Technik“ stellen wir Konstrukteuren jede Woche beeindruckende Projekte aus Forschung und Entwicklung vor. Heute: die Kopplung von Windrad und Elektrolyse zur emissionsfreien Wasserstofferzeugung.
Anbieter zum Thema

Wasserstoff ist ein chemisches Element, dessen Energiegehalt in Brennstoffzellen genutzt werden kann. Da Wasserstoff aber nur in gebundener Form vorkommt, muss er mithilfe von Energie abgespalten werden. Je nach Ausgangsstoff und Energieform wird in grünen, grauen, blauen oder türkisen Wasserstoff unterschieden.
Bisher wird Wasserstoff hauptsächlich aus Erdgas durch Zugabe von Wasserdampf (Dampfreformierung) erzeugt (grauer Wasserstoff) oder unter Zugabe von Hitze (Pyrolyse) gespalten (Türkiser Wasserstoff). Kann das bei der Dampfreformierung entstandene CO2 aufgefangen oder weiterverwendet werden, spricht man von blauem Wasserstoff.
Grüner Wasserstoff aus Wasser
Eine Emissionsfreie Erzeugung von Wasserstoff kann mit der Wasserelektrolyse gelingen. Dabei wird Wasser unter Einsatz von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Der Wasserstoff wandert zum negativ geladenen und der Sauerstoff zum positiv geladenen Pol. Die eingesetzte elektrische Energie wird in chemische Energie umgewandelt und im Wasserstoff gespeichert. Stammt der eingesetzte Strom aus erneuerbaren Energien, wird sogenannter grüner Wasserstoff erzeugt.
Windenergieanlagen mit integriertem Elektrolyseur
Bei den in Deutschland installierten Elektrolyseanlagen handelt es sich bisher um Demonstrations- und Forschungsprojekte. Das soll sich durch die Förderung des Bundes für drei Wasserstoff-Leitprojekte bald ändern. Autarke Einheiten aus Windenergieanlage und integriertem Elektrolyseur könnten dann in Zukunft grünen Wasserstoff im Industriemaßstab herstellen und die Kosten für einen elektrischen Netzanschluss sparen. In einem zweiten Schritt soll der grüne Wasserstoff in weitere synthetische Kraftstoffe und Energieträger umgewandelt werden. Damit könnte ein maßgeblicher Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen geleistet werden.
Das Leitprojekt H2Mare
Das Leitprojekt H2Mare zielt darauf ab, dass künftig ein völlig neuer Windanlagentyp auf dem Meer seinen Platz findet: Dieser integriert einen Elektrolyseur zur direkten Wandlung des elektrischen Stromes in chemische Energie und erzeugt so grünen Wasserstoff. Darüber hinaus werden weiterführende Offshore-Power-to-X-Verfahren (PtX) untersucht.
Dazu wird die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet: von der Windenergie-Gewinnung und Wasserstoff-Erzeugung über die Wandlung von Wasserstoff in Methan, flüssige Kohlenwasserstoffe, Methanol oder Ammoniak bis zum Verbrauch durch die Industrie oder Energiewirtschaft. Somit sind verschiedene industrielle Anschlussverwertungen und Speicheroptionen möglich. Ein signifikanter Kostenvorteil bei der Herstellung großvolumiger Wasserstoffmengen ist das Ziel.
35 Projektpartner wollen in vier Verbundprojekten innerhalb von vier Jahren mit H2Mare den Grundstein für eine Technologieführerschaft legen und die Erreichung von Klimazielen durch beschleunigte Treibhausgasreduktion unterstützen. Siemens Energy verantwortet die übergreifende Koordination von H2Mare mit Unterstützung von Instituten der Fraunhofer Gesellschaft.
Die vier H2Mare-Verbundprojekte
Die vier H2Mare-Verbundprojekte werden unabhängig voneinander vorangetrieben:
- OffgridWind: verfolgt die Umsetzung eines Anlagenkonzeptes, das die Elektrolyse direkt in der Offshore-Windenergieanlage realisiert und dabei auf einen hohen Wirkungsgrad abzielt.
- H2Wind: beinhaltet die Entwicklung einer an die Offshore-Umgebung optimal angepasste und auf die Windenergieanlage abgestimmte PEM-Elektrolyse (PEM = Proton Exchange Membrane). Neben der Langlebigkeit der Anlagen und der Herausforderung der Meerwasseraufbereitung ist die maximale Ausbeute der Windenergie ein Ziel des Projektes.
- PtX-Wind: Im Unterschied zur reinen Offshore-Wasserstoffproduktion steht die Wandlung in leichter transportierbare, synthetische Energieträger und Kraftstoffe wie Methanol und Ammoniak im Fokus. Über die Hochtemperatur-Elektrolyse und die CO2-Gewinnung aus der Luft oder aus dem Meer werden die Power-to-X-Produkte erzeugt. Auch eine direkte Salzwasserelektrolyse wird erprobt.
- TransferWind: Wissenstransfer in die Öffentlichkeit als auch der inhaltliche Projekt-übergreifende Fachaustausch werden in TransferWind adressiert. Dabei werden auch Sicherheits- und Umweltfragen sowie Infrastrukturanforderungen betrachtet.
Integration von Einzelprozessen zu Gesamtsystemen
Ein wichtiger Teil der Untersuchungen ist die Integration von Einzelprozessen zu Gesamtsystemen: zum Beispiel kann durch die Wärmeintegration der Hochtemperatur-Elektrolyse in PtX-Verfahren der Wirkungsgrad des Gesamtprozesses erhöht werden. Dies umfasst auch die Konzeption zur Lagerung und zum Abtransport des Wasserstoffs oder anderer Power-to-X-Produkte per Schiff und Pipeline. Die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Prozessen und der Anlage sowie ihre Auswirkung auf die Umwelt am Standort werden für den gesamten Lebenszyklus untersucht, bewertet und weiterentwickelt.
Weitere Informationen zum Thema Wasserelektrolyse
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1849200/1849231/original.jpg)
Forschungsprojekt
Grüner Wasserstoff für neuartige Ackerfahrzeuge
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1839600/1839636/original.jpg)
Stromversorgung
Eine zuverlässige Stromversorgung für die Wasserstoffelektrolyse
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1829900/1829994/original.jpg)
Faszination Technik
Wie Energie aus Meerwasser gewonnen werden kann
(ID:47601751)




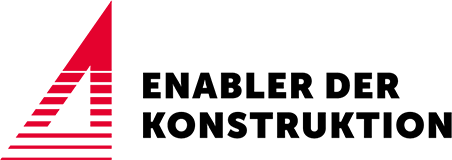
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/52/7a/527ad5ae7d10b9e34b72570639d7870c/plagiarius-zwerg-gnome-2849x1602v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ef/04/ef0475f1203cde94bf9dfde98fd7345b/0129243542v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8a/12/8a1258b6d4701a389972fbb92278f515/0129242059v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/82/df/82df058e441537e2123e8d0ee81c22be/bank-notes-941246-1280-1280x720v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/ef/1defae065aa8e85d07d6ee617335c88f/0128924879v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/65/75655982e3a71a70efcf8c1de423bc13/0128784466v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/39/42/3942b4485d407f41c125113ab81cfc08/grenzebach-am-fsw-gads-herfert-gfsw-burmann-spin-off-close-shot-2000x1125v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/da/7e/da7e5a5df4c0efb2a27aa760dd94ba4f/0129346755v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5e/9b/5e9b393c4e5d987e895de5ce4527df87/0129242091v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/42/18421d21f5a2ad15081c1a738e84850f/0128496303v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/97/54/97546a872190f725e761a6504088f5b9/0127947665v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/c2/75c2648ac64e595c51904d8dbaceabea/0128063829v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/ad/e1ad97c78305431215cab0ae08ddfc1e/laj987-digital-grading-10006743-1280-1280x720v1.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/8b/ec8b9c991b5c25fdc483a9c4f062c01f/adobestock-340905887--c2-a9-20gorodenkoff-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5120x2877v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6d/b5/6db5864ad31a14bd4db1e228f983c259/adobestock-1336831159--c2-a9-20magele-picture-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5184x2915v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bc/49/bc4957f73a884d8ee1356914659cf2f4/adobestock-325234002--c2-a9-20karyna-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5490x3087v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7a/22/7a22898e1ee01157399158bd2d7f26c6/0128676654v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/46/c9/46c97200605642d8b8f9bc9ac014316a/0128359318v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/16/7916e9b7731fb39679d596d16f918a8f/0127591377v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/93/e193cd7df3b15859208fa33b610588ad/0127840781v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/61/4f/614f0d08c8ea93498a6c6883d7701f25/0126917376v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/89/c7894b3aecafb36267fab2853c93499c/0126696654v1.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/90100/90177/65.jpg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/130700/130777/65.jpg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/64/1b/641b1b39912ca/heraeus-wm-amloy-untereinander-rgb.png)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/90/a6/90a62ce73446f6fafff4d2572c3ea6c3/0125761091v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f4/4c/f44c01031a99b8321ca07b46f9064f6f/0124646787v2.jpeg)