Kamerasensorik und Beleuchtung So wählen Sie die richtige Beleuchtung für Kamera-Applikationen
Mit Kamerasensoren werden häufig spezifische Merkmale an Objekten überprüft. Um dabei möglichst optimale Ergebnisse zu erzielen, ist vor allem die passende Beleuchtung wichtig. Hier finden Sie Tipps für deren Auswahl.
Anbieter zum Thema

Die Prüfergebnisse in einer Anwendung mit einem Kamerasensor werden zu einem Großteil auch durch die Beleuchtung bestimmt. Doch angesichts der Vielzahl an unterschiedlichen Beleuchtungstechniken, die für Kamerasensoren zur Verfügung stehen, fällt die Wahl einer Lösung für eine konkrete Applikation oft schwer: Sowohl für Auflichtbeleuchtungen (hier befindet sich die Lichtquelle oberhalb einer Objektebene) als auch Durchlichtbeleuchtungen (die Lichtquelle befindet sich unterhalb einer Objektebene) existieren zahlreiche Lösungen, für die zudem mehrere Beleuchtungstechniken bereitstehen.
Auflichtbeleuchtungen und ihre Einsatzmöglichkeiten
Für Auflicht stehen in der Regel folgende Beleuchtungstechniken zur Verfügung:
- gerichtete koaxiale Beleuchtung (z. B. Ringbeleuchtung, Dome-Beleuchtung)
- diffuse koaxiale Beleuchtung (z. B. Ringleuchte mit Diffusor, Flat-Dome)
- telezentrische Beleuchtung
- Dunkelfeldbeleuchtung (flache Ringlichter, Linienlichter oder Spotlights)
Gerichtete koaxiale Beleuchtung
Bei einer gerichteten koaxialen Beleuchtung wird das Licht parallel zur Achse der Kameraoptik auf ein Objekt projiziert. Der Begriff „koaxial“ beschreibt eine gleichachsige Abstrahlung des Lichts zur Kameraoptik. Die Lichtquelle ist daher gewissermaßen um die Optik der Kamera herum angeordnet, z. B. eine Ringbeleuchtung.
Da die Lichtquellen mittlerweile nahezu ausnahmslos aus LEDs bzw. LED-Arrays bestehen, integrieren die bei Auflicht verwendeten Beleuchtungstechniken mitunter einen Diffusor in Form einer Streuscheibe oder matten Abdeckung, um eine möglichst homogene Lichtverteilung auf einer Prüffläche zu erhalten. Das austretende Licht wird hierbei direkt auf die Objektebene abgestrahlt (Abb. 1).
Potenzielle Einsatzbereiche: Insbesondere Prüfobjekte mit ebener, glatter, reflektierender oder glänzender Oberfläche, wie Unterlegscheiben (z. B. Prüfung des Objektdurchmessers) oder Elektronikbauteile, an denen z. B. die Vollständigkeit von Kontakten geprüft werden soll (Abb. 2).
Dome-Beleuchtung mit koaxialer Lichtquelle
Unter den gerichteten koaxialen Beleuchtungstechniken ermöglicht die Dome-Beleuchtung eine äußerst gleichmäßige Ausleuchtung eine Prüfobjektes. Da die über dem Dome positionierte Kameraoptik für die Aufnahmen der Objektebene eine Öffnung benötigt, wäre auf dem Kamerabild normalerweise im Zentrum der Objektebene ein dunkler Bereich zu sehen, von dem das Licht nicht reflektiert wird. Zur Vermeidung dieses Effektes integrieren hochwertige Dome-Beleuchtungen in der Regel eine seitlich zur Kameraoptik installierte Lichtquelle, die das Licht über einen Strahlteiler in Richtung Objektebene lenkt (Abb. 3).
Potenzielle Einsatzbereiche: Komplexere reflektierende Objekte wie z. B. Folien, Kronkorken von Flaschen oder Datenträger wie Blue-Rays, CDs, DVDs.
Diffuse koaxiale Beleuchtung
Eine diffuse koaxiale Beleuchtung (Abb. 4) lässt sich z. B. durch eine diffuse Abdeckung auf einer Ringleuchte realisieren. Das austretende Licht strahlt hierbei ungerichtet bzw. stark gestreut auf die Objektebene ab. Mit dieser Beleuchtungstechnik wird ein diffuses und somit sehr homogenes, also gleichmäßig verteiltes Licht erzeugt.
Potenzielle Einsatzbereiche: Ideal für reflektierende Objekte mit unebener Oberfläche, z. B. zur Prüfung von Rohren, wobei nicht nur deren Scheitelpunkt, sondern auch Randbereiche durch die bessere Lichtverteilung eindeutiger erkennbar werden und sich somit auch deutlicher bzw. kontrastreicher von einem Hintergrund abheben.
Diffuse koaxiale Beleuchtung: Flat-Dome
Der sogenannte Flat-Dome (Abb. 5) stellt eine besondere Form der diffusen koaxialen Beleuchtung dar und liefert ein ungerichtetes Licht, das sich sehr gleichmäßig auf einer Objektoberfläche verteilt. Allerdings muss die Beleuchtung hierzu sehr nahe an die Objektoberfläche herangeführt werden, um auswertbare Bildergebnisse zu erhalten.
Potenzielle Einsatzbereiche: Glänzende, unebene Objektoberflächen, die außerdem während der Prüfung in ihrer Lage variieren können.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1539900/1539996/original.jpg)
Robotik
Roboter mit Kamerasystem behält bei Montage den Überblick
Telezentrische Beleuchtung
Im Gegensatz zu einer gerichteten oder diffusen koaxialen Beleuchtung haben die Lichtstrahlen bei einer telezentrischen bzw. kollimierten Beleuchtung keinen Öffnungswinkel (Abb. 6). Die Lichtstrahlen treffen stattdessen, bspw. mithilfe einer speziellen Richtoptik, parallel zur Kameraoptik auf ein Prüfobjekt.
Potenzielle Einsatzbereiche: Untersuchung insbesondere von Kratzern, Kanten oder Oberflächenstrukturen mittels Auflicht.
Hellfeld-/partielle Hellfeldbeleuchtungen
Die bisher beschriebenen Beleuchtungstechniken lassen sich mit Blick auf die Beleuchtungsrichtungen als Hellfeld- bzw. partielle Hellfeldbeleuchtungen bezeichnen. Mit ihnen wird im Grunde die direkte Reflexion der Lichtstrahlen von einem Prüfobjekt bzw. von einer Objektoberfläche ausgewertet. Ein „echtes“ Hellfeld lässt sich indes strenggenommen nur durch eine telezentrische Beleuchtungstechnik bei Auflicht erzeugen, da hier die Lichtstrahlen hauptsächlich von der Objektoberfläche in Richtung Kameraoptik reflektiert werden. Dabei ist die reflektierte Lichtmenge sehr stark von der Oberflächenstruktur abhängig, wobei sich im Idealfall kontrastreiche Abbildungen der Oberflächenstruktur ergeben.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1535300/1535381/original.jpg)
Bildverarbeitung
Das Auge der Maschine
Dunkelfeldbeleuchtungen
Beleuchtungstechniken zur Erzeugung eines Dunkelfeldes werden zumeist in einem sehr geringen Abstand zu einem Prüfobjekt positioniert. Dunkelfeldbeleuchtungen können bspw. aus flachen Ringlichtern, Linienlichtern oder sogenannten Spotlights bestehen (Abb. 8)
Das von einem Prüfobjekt reflektierte Licht wird bei der Dunkelfeldbeleuchtung mit Auflicht zu einem Großteil auf Bereiche außerhalb der Kameraoptik gelenkt. Die Kameraoptik erfasst lediglich die Reflexionen der Lichtstrahlen von den Objektunebeneinheiten, wodurch Fehler, Defekte oder spezifische Objektmerkmale im Kamerabild als helle Bereiche gut erkennbar sind.
Potenzielle Einsatzbereiche: Ideal zur Detektion von Fehlern auf Objektoberflächen (z. B. Kratzer oder Riefen) oder zur Prüfung von Gravuren (Abb. 8).
Durchlichtbeleuchtungen und ihre Einsatzmöglichkeiten
Bei Durchlicht- oder Hintergrundbeleuchtungen wird zwischen folgenden Beleuchtungstechniken unterschieden:
- telezentrische Beleuchtung
- Hellfeld-Durchlichtbeleuchtung (diffuse oder gerichtete Durchlichtbeleuchtung)
- Dunkelfeld-Durchlichtbeleuchtung
- transmissive Beleuchtung
Telezentrische Beleuchtung
Telezentrische Beleuchtungstechniken liefern bei Durchlicht eine exakte Abbildung der Prüfobjekte, weitestgehend frei von Beugungseffekten (Abb. 9). Wird ein Objekt hingegen mit einer Standard-Durchlichtbeleuchtung von hinten angestrahlt, verändert sich sein Schattenbild bzw. das Schattenbild des Prüfbereichs mit zunehmendem Abstand der Beleuchtung zum Objekt (Abb. 9). Das Schattenbild ist aufgrund der Ablenkung bzw. Beugung der Lichtstrahlen an der Objektkante nicht mehr klar abgegrenzt. Dieser Effekt wird um so schwächer, je telezentrischer das Licht (kollimiertes Strahlenbündel) ist.
Potenzielle Einsatzbereiche: Für präzise Messaufgaben an Prüflingen bei Durchlicht, das mit einer telezentrischen Beleuchtungstechnik und einem telezentrischen Kameraobjektiv einen guten Kontrast zwischen Objekt und Hintergrund liefert, z. B. bei tiefen Bohrungen (Abb. 10).
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1371600/1371629/original.jpg)
Smarte Kamera
Smarte Kamera kontrolliert Qualität in High Speed
Hellfeld-Durchlichtbeleuchtung
Bei dieser Beleuchtungstechnik wird ein Prüfobjekt von unten bzw. von hinten so angeleuchtet, dass die Strahlen der Lichtquelle in Richtung Kameraoptik geleitet werden (Abb. 11). Es entsteht somit eine Art Schattenbild vom Prüfobjekt, bei dem der Objekthintergrund als heller Bereich im Bild des Kamerasensors erkennbar ist.
Potenzielle Einsatzbereiche: Kontrolle, ob bspw. an Objekten spezifische Merkmale vorhanden sind oder nicht (etwa Ausstanzungen oder Bohrungen), ohne jedoch hohe Maßanforderungen an das Prüfergebnis zu stellen. Je nach Anforderungen an die Prüfaufgabe sollten Lichtquellen mit diffuser oder gerichteter Beleuchtung eingesetzt werden. Eine klassische Anwendung ist die Prüfung von Kunststoff-Spritzteilen, wobei anhand des Schattenwurfs der Prüflinge im Kamerabild kontrolliert wird, ob bestimmte Produktbereiche fehlen bzw. im Vergleich zur gewünschten Form abweichen.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1603200/1603293/original.jpg)
Deep Learning
Sensor-Funktionalitäten mit Deep Learning spezialisieren
Dunkelfeld-Durchlichtbeleuchtung
Gewisse spezifische Oberflächenmerkmale von transparenten Objekten können mit dieser Beleuchtungstechnik sehr gut hervorgehoben werden, z. B. Kratzer auf einer Plexiglasscheibe. Bei einer Dunkelfeld-Durchlichtbeleuchtung sind die Kratzer auf der Objektoberfläche im Kamerabild als helle Bereiche deutlich erkennbar, die sich kontrastreich und damit eindeutig vom Rest der Plexiglasscheibe (in der Bildausgabe als dunkler Bereich dargestellt) abheben (Abb. 12).
Transmissive Beleuchtung
Die transmissive Beleuchtung ist eine besondere Form der Dunkelfeld-Durchlicht-Beleuchtung, weil das Licht bei dieser Technik quasi in ein transparentes Objekt injiziert wird (Abb. 13). Der Prüfling hat somit gewissermaßen die Rolle eines Lichtleiters, durch den das Licht passieren kann.

Potenzielle Einsatzbereiche: Die Prüfung von transparenten Objekten z.B. auf Risse, Riefen, Kratzer, aber auch Verformungen. Solche Defekte sind im Kamerabild sehr gut erkennbar, da sich an ihnen das Licht bricht, wobei die Lichtstrahlen zur Kameraoptik hin reflektiert werden.
* Christian Fiebach ist Geschäftsführer der ipf electronic GmbH
(ID:46281035)




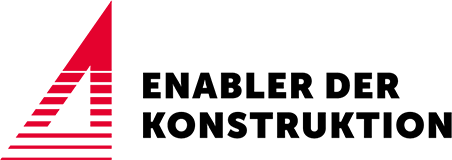
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/db/58/db58d50add37b2bc32dcbff86b1e1f0c/0129007282v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d9/88/d9884abeffa00e8ccf0c16e2bf9d467a/0128935043v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/65/75655982e3a71a70efcf8c1de423bc13/0128784466v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/82/df/82df058e441537e2123e8d0ee81c22be/bank-notes-941246-1280-1280x720v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/ef/1defae065aa8e85d07d6ee617335c88f/0128924879v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/33/5c/335c0ce49c2019c75c5e3c7ee9a89b68/1x1-meldung-800x450v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/91/45/91456f599a95308e641d854b08d99305/0129062501v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/34/76/347665b4a52aaba38675a8e52a13aa67/0129038083v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/42/18421d21f5a2ad15081c1a738e84850f/0128496303v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/97/54/97546a872190f725e761a6504088f5b9/0127947665v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/c2/75c2648ac64e595c51904d8dbaceabea/0128063829v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/8b/ec8b9c991b5c25fdc483a9c4f062c01f/adobestock-340905887--c2-a9-20gorodenkoff-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5120x2877v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6d/b5/6db5864ad31a14bd4db1e228f983c259/adobestock-1336831159--c2-a9-20magele-picture-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5184x2915v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/60/af/60afa3fc9e00296f2cb9a930656fc679/0128763796v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7a/22/7a22898e1ee01157399158bd2d7f26c6/0128676654v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/46/c9/46c97200605642d8b8f9bc9ac014316a/0128359318v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/16/7916e9b7731fb39679d596d16f918a8f/0127591377v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fa/52/fa52f34c60f4bd6bf6f408a9fef7b316/0127095437v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/93/e193cd7df3b15859208fa33b610588ad/0127840781v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/61/4f/614f0d08c8ea93498a6c6883d7701f25/0126917376v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/89/c7894b3aecafb36267fab2853c93499c/0126696654v1.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/125200/125230/65.png)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/63/88/63887b860cf66/me-logo-400px.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/20800/20842/65.jpg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7a/18/7a187719acb089f39f4788488410065c/0127281539v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/eb/e4/ebe42d730cf9750eb5cf36afe8d28af9/0127247221v2.jpeg)