Materialforschung Wie entstehen Risse?
Die Mathematikerinnen Dr. Dorothee Knees und Dr. Christiane Kraus vom Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik in Berlin untersuchen, wann Materialien brechen und wie sie länger halten. Diese Prozesse wollen sie mit mathematischen Methoden modellieren.
Anbieter zum Thema
Aus einem winzig kleinen Riss wurde 1998 in Eschede das größte deutsche Zugunglück. Seitdem gibt es immer wieder Unsicherheiten, weil Risse in Radreifen von ICEs entdeckt werden. Wann entstehen solche Schäden im Material? Wie lange geht es gut, und wann kommt es zum Bruch? Dr. Dorothee Knees und Dr. Christiane Kraus vom Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik in Berlin wollen diese Prozesse mit mathematischen Methoden modellieren, damit es gar nicht erst zur Katastrophe kommt.
Mathematikerinnen interessiert Übergang zum Bruch
Wenn ein Bauteil kaputt geht, zerbricht der Werkstoff nicht von einem Moment auf den anderen, sondern vorher treten winzige Risse und Hohlräume auf. Bei Beton sind sie ein bis zehn Zentimeter groß, bei Lötmaterialien ein Tausendstel Millimeter und kleiner. Diese mikroskopischen Schäden entstehen meistens an solchen Stellen im Bauteil, an denen verschiedene Materialien zusammentreffen. Chemische Reaktionen und Entmischungen, aber auch Temperatureinflüsse und äußere Belastungen, rufen an diesen Stellen hohe mechanische Spannungen hervor, die zu einer lokalen Schädigung des Bauteils führen. Wenn die Risse wachsen und sich vereinigen, wird der Werkstoff weniger stabil, bis er schließlich bricht. Bisher werden mikroskopische Schädigungsprozesse und makroskopische Bruchmechanismen isoliert voneinander analysiert. „Uns interessiert vor allem der Übergang: Wann geht die Schädigung in einen Bruch über?“ erläutert Christiane Kraus.
Unterscheidung in „total geschädigt“ und „ungeschädigt“
Die Forscherinnen betrachten den Übergang zwischen den Bereichen „total geschädigt“ und „ungeschädigt“ zunächst nicht als scharfe Bruchfläche, sondern als einen Bereich, in dem die Zustände stetig ineinander übergehen. In das Modell, das die Schädigung beschreibt, fließen Größen wie die mittlere Länge der Mikrorisse, deren Anzahl und Orientierung ein. Die Evolution des Schädigungsprozesses beschreiben dann spezielle Gleichungen, die partiellen Differentialgleichungen. Um zum makroskopischen Bruchmodell zu kommen, lassen die Mathematikerinnen in ihrem Modell den stetigen Übergang immer kleiner werden, so dass er verschwindend klein wird und als scharfe Bruchfläche erscheint.
Team mit Experten aus anderen Fachbereichen stärken
Das Projekt der beiden Mathematikerinnen wird vom Senatsausschuss Wettbewerb der Leibniz-Gemeinschaft im Schwerpunkt „Frauen in wissenschaftlichen Leitungspositionen“ gefördert. Damit können die Wissenschaftlerinnen für drei Jahre eine Arbeitsgruppe zur mathematischen Modellierung finanzieren. Durch zusätzliche Drittmittel wollen sie ihr Team mit Experten aus anderen Fachbereichen verstärken, da beim Modellieren von Schädigungsprozessen auch Materialwissenschaften, Thermodynamik und Chemie eine wichtige Rolle spielen.
(ID:276213)




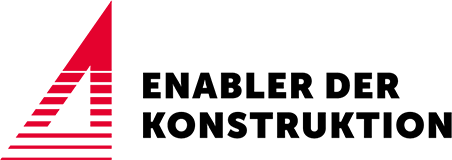
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e0/ef/e0ef4a7fe986a68c6fb828ad82a65701/newsimage418231-1440x810v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5f/0b/5f0b02765df72e8959c1f4ffcf4019a3/newsimage418028-2772x1559v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/52/7a/527ad5ae7d10b9e34b72570639d7870c/plagiarius-zwerg-gnome-2849x1602v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/82/df/82df058e441537e2123e8d0ee81c22be/bank-notes-941246-1280-1280x720v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/ef/1defae065aa8e85d07d6ee617335c88f/0128924879v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/65/75655982e3a71a70efcf8c1de423bc13/0128784466v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/14/54/14548e16d0a6ba249c025bc7c322953e/0129540459v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/39/42/3942b4485d407f41c125113ab81cfc08/grenzebach-am-fsw-gads-herfert-gfsw-burmann-spin-off-close-shot-2000x1125v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/da/7e/da7e5a5df4c0efb2a27aa760dd94ba4f/0129346755v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/42/18421d21f5a2ad15081c1a738e84850f/0128496303v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/97/54/97546a872190f725e761a6504088f5b9/0127947665v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/c2/75c2648ac64e595c51904d8dbaceabea/0128063829v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/ad/e1ad97c78305431215cab0ae08ddfc1e/laj987-digital-grading-10006743-1280-1280x720v1.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/8b/ec8b9c991b5c25fdc483a9c4f062c01f/adobestock-340905887--c2-a9-20gorodenkoff-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5120x2877v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6d/b5/6db5864ad31a14bd4db1e228f983c259/adobestock-1336831159--c2-a9-20magele-picture-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5184x2915v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bc/49/bc4957f73a884d8ee1356914659cf2f4/adobestock-325234002--c2-a9-20karyna-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5490x3087v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7a/22/7a22898e1ee01157399158bd2d7f26c6/0128676654v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/46/c9/46c97200605642d8b8f9bc9ac014316a/0128359318v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/16/7916e9b7731fb39679d596d16f918a8f/0127591377v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/93/e193cd7df3b15859208fa33b610588ad/0127840781v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/61/4f/614f0d08c8ea93498a6c6883d7701f25/0126917376v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/89/c7894b3aecafb36267fab2853c93499c/0126696654v1.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/76800/76895/65.jpg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/af/19/af197c1fa68e9fff7d553428ea524a76/0126060669v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d2/e4/d2e49cc7f242fe3540c3586308656717/0124731740v1.jpeg)